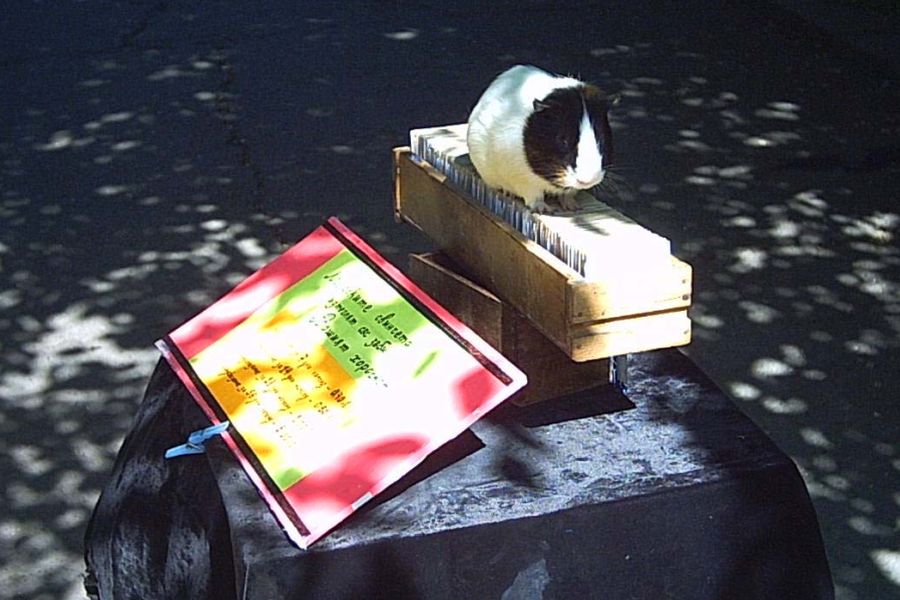Bis zur Grundschule waren es jeden Tag drei Kilometer. Nichts gegen das, was unsere Eltern zu ihrer Zeit hinter sich brachten. Aber ich lief den Schulweg schon als Sechsjähriger allein, jeden Morgen. Ich schreibe das, weil ich seit zwanzig Jahren keinen Grundschüler mehr habe alleine rumlaufen sehen. Ich steckte das Pausenbrot ein, das meistens aus einer Rühreier-Stulle bestand und lief am Marktplatz an der Erdgeschosswohnung vorbei, die mir sechs Jahre später mein erstes erotisches Erlebnis bescheren würde. Dann an der Kneipe vorbei, die meistens noch auf hatte und in der ich für Opa abends Bier in Krügen holte. In der nächsten Straße gab es einen Nachtklub namens „Monis Paradies“, der den Eltern des Jungen gehörte, der in der Klasse neben mir saß. Dann die Hauptstraße lang am Supermarkt vorbei, in dem ich meine erste Mutprobe mit dem Klauen von Haushaltsgummis bestand und schließlich an Cornelias Wohnhaus vorbei, wo sie meistens schon stand, um mich über die Brücke, den Schulhof der älteren Hauptschüler und durch den Park zu begleiten, bis wir schließlich ankamen.
Wie ich aus über achtzig Grundschülern in zwei Grundschulklassen ausgerechnet auf Cornelia als „beste Freundin“ kam, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, sie war einfach die hübscheste Person, die ich je zuvor in meinem Leben gesehen hatte und das reichte mir als Grund. Ich wollte immer in ihrer Nähe sein und war richtig stolz, wenn sie schon auf mich wartete und wir den Rest des Schulwegs gemeinsam liefen. Sie hatte lustige Sommersprossen und lachte, dass ich immer mitlachen musste. Als Buddies kamen sonst nur wenige Jungs in Frage, weil sie sich fast alle ständig streiten und prügeln mussten – und das war einfach nicht mein Ding. Die Regeln waren einfach. Es gab mir ein Gefühl von Sicherheit, neben dem dicken Armin zu sitzen, weil sich niemand mit ihm angelegt hätte. Und deshalb musste ich mich auch nie prügeln, weil er auf mich aufpasste. Seine ebenso dicke Schwester namens Elke, die ihm im Streit um ein paar Legosteine mal eine Colaflasche über die Birne zog, war auch in meiner Klasse. Seitdem hatte Armin eine Riesennarbe auf dem Schädel, die er mir gleich am ersten Tag zeigte.
In der Bar von Armin und Elkes Eltern bei mir um die Ecke arbeitete wiederum Cornelias Mutter, die sich so als „Animierdame“, wie meine Mutter das nannte, ihre Brötchen verdiente. Ich hatte keine Ahnung, was eine Animierdame so macht, aber sie verließ jeden Abend um Neun das Haus, erzählte mir Cornelia, und lag schon vor dem Aufstehen ihrer Töchter wieder im Bett und schlief. Conny hatte drei Schwestern und sie war die Zweitälteste, was irgendwie bedeutete, ihre beiden jüngeren Geschwister mit zu versorgen. Meistens kam sie ohne Schulbrot raus, aber dafür mit Geld für uns beide und wir bogen kurz vor der Schule zum Bäcker ab. Der Renner dort war ein Brötchen namens Doppelweck, auf das man sich zwei „Mohrenköpfe“ klatschte – als Frühstück unschlagbar. Was Conny für ihre Schwestern und den Haushalt leistete, war mir damals überhaupt nicht klar, aber es muss mehr gewesen sein, als ich es verkraftet hätte. Manchmal kam sie nicht wie verabredet zum Spielen, weil sie die Wäsche ihrer Schwestern, deren Hausaufgaben oder sonstwas erledigte, während ich den Nachmittag über frei hatte. Ich verstand einfach nicht, was das an Arbeit bedeutete – es ging in meinen kleinen Kopf nicht rein, weil ich es nicht kannte.
Und überhaupt. Die alleinverdienende Nachteule mit ihren vier Töchtern wurde im Haus und überall, wo man über ihren Job bescheid wusste, verachtet. Ich ertappte sogar die Lehrerin mal dabei, als sie im Zusammenhang mit Conny von schlechtem Umgang sprach. Ich glaube, Conny mochte mich vor allem, weil ich mir nichts draus machte. Sie trug Klamotten, die auch beim besten Wohlwollen nicht mehr als zeitgemäß durchgingen – selbst damals nicht. Auf einem der wenigen Fotos, die ich von ihr habe, trägt sie eine graue Karohose und dazu eine rosafarbene Jacke mit Flicken aus Kunstleder und zotteligen Kunstfasern, die nach allen Seiten abstehen. Noch trug niemand Markenklamotten bei uns, es war Anfang der Siebziger, aber was sie da trug, war weit weg von einfach allem, was man sich vorstellen kann. Sie sah in ihren bunten Kleidern ein bisschen so aus wie Pippi Langstrumpf, nur ohne Zöpfe. Conny war das pupsegal, jedenfalls tat sie so und wenn jemand lästerte, hörte sie es erst gar nicht und genau deswegen hörte ich es auch nicht. Sie war einfach der beste Kumpel, den man sich vorstellen konnte. Sie hätte mir den Weg freigeschossen, wenn es darauf angekommen wäre – und Armin hätte die Leichen weggeräumt.
Ich mochte sie vom ersten Augenblick an und ich war gern mit ihr zusammen. Sie war die erste Person meines Lebens, mit der ich mich unterhalten konnte und wir zwitscherten wie zwei Graupapageien miteinander. Sie strahlte sowas Vertrauensvolles, Ehrliches, Einfaches aus, was mich sofort faszinierte. Das war genau die Art von Mädchen, so stellte ich mir vor, die ich später mal zur Frau haben mochte. Gleichzeitig hätte ich sie furchtbar gern zur Schwester gehabt und eines Tages sagte sie mir, sie würde mich gern gegen jede einzelne ihrer Schwestern tauschen. Morgens berieten wir uns, ob wir alles dabei hatten, was wir zum Unterricht brauchten. Das Problem war meist der Bastelunterricht. Stifte, Reißzwecke, bestimmte Papiersorten wie dieses Goldpapier oder Haushaltsgummis. Dinge, die wir nicht hatten und die wir uns kaufen mussten. Hätte ich auch nur einmal dran gedacht, hätte mir Mama das Geld dafür gegeben. Aber Conny war die Managerin und ich verließ mich blind auf sie. Sie wusste immer, was zu tun war. Es ging jedes mal gut, wenn wir im Supermarkt bei der Kassiererin vorbei schlichen, aber mir war schlecht vor Angst. Conny blieb cool und lächelte einfach gnadenlos jeden an.
Nach zwei Jahren wechselte ich die Grundschule und wir sahen uns seltener, aber erst als ich ins Gymnasium gehen sollte und sie es nicht durfte, verlor ich sie endgültig aus den Augen. Viele Jahre dachte ich an sie und fragte mich, was wohl aus ihr geworden war. Mit Achtzehn oder Neunzehn sah ich sie für einen kurzen Augenblick wieder und erkannte sie sofort, inmitten von Freaks und Punks am Marktbrunnen in der Fußgängerzone. Sie stemmten Bier und Schnaps und sie war eines von zwei Mädchen, alle anderen waren Jungs. Sie entdeckte mich und für einen ganz kurzen Moment sah sie mir in die Augen und lachte so, wie ich es liebte. Dann sah sie zu Boden, klappte ihren Unterarm nach vorne aus und zog sich den Pulli hoch. Ich denke heute, dass ich die Nadelstiche sehen sollte, aber ich weiß nicht, warum sie das tat. Eine Menge wirrer Gedanken schossen mir durch den Kopf, als ich sie da sitzen sah, mitten unter anderen Junkies und sie wollte mich einfach nicht mehr ansehen. Und dann ging ich weiter aus Angst, irgendwas falsch zu machen.
Dann vergingen weitere zehn Jahre, bis mir jemand, den ich eher zufällig auf einem Festival kennenlernte, ihre Adresse steckte. Es war ein kleines Zweifamilienhaus mit einer Klingel, auf der „Wohngemeinschaft 14“ stand. Ich nahm all meinen Mut zusammen und drückte drauf. Die Tür ging auf. „Ist Conny da?“ fragte ich und erkannte sie im gleichen Augenblick wieder. Sie sah verdammt mitgenommen aus, aber lächelte immer noch tapfer ihr süßes Grundschul-Lächeln. „Komm rein“, sagte sie. Ich folgte ihr nach drinnen und setzte mich auf den Sessel gegenüber von ihr. Ich sah mich nicht um. Ich sah sie fragend an. Sie blickte zurück, sah meine Frage und als ob wir noch die gleichen kleinen Kinder wären, die wir waren, erzählte sie mir alles in einem Rutsch. Einfach alles, was passiert war. Die ganzen letzten fünfzehn Jahre. Sie redete zwanzig, dreißig Minuten an einem Stück, ohne große Emotionen und wirkte dabei ziemlich geschäftig. Anscheinend war sie der Meinung, dass ich das Recht dazu hatte, alles zu erfahren. Sie erstattete Bericht und sie behielt ihre Distanz das ganze Gespräch über bei. Ich hörte mir alles über die Drogen, das Geld, die Entziehungskuren, Abtreibungen, Selbstmorde und die ganzen Arschlöcher an, die sie ausgenutzt hatten. Sie saß ziemlich tief in der Tinte, aber sie begann gerade damit, sich wieder freizuschwimmen. Jedenfalls erzählte sie das.
Dann sagte sie, sie müsse mich jetzt rauswerfen und dass sie noch einiges zu tun hätte. Und ich sagte, das kann ich verstehen – und ging.
*************